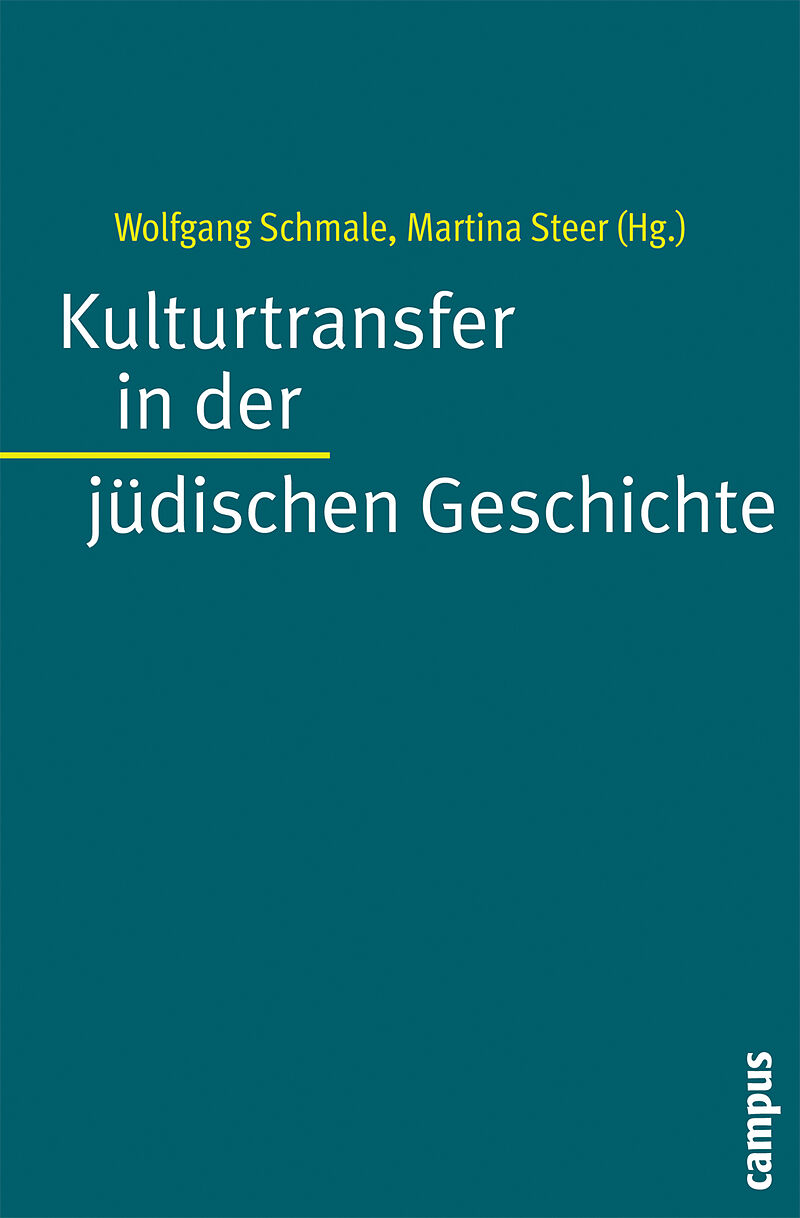Kulturtransfer in der jüdischen Geschichte
Einband:
Paperback
EAN:
9783593382081
Untertitel:
Deutsch
Genre:
Kulturgeschichte
Herausgeber:
Campus Verlag GmbH
Auflage:
1. Aufl. 10.2006
Anzahl Seiten:
194
Erscheinungsdatum:
31.10.2006
ISBN:
978-3-593-38208-1
Kultur und Geschichte
Kulturelle Austauschprozesse sind ein in Bezug auf die jüdische Geschichte bislang vernachlässigtes Thema. Dabei übernahmen Juden häufig Werte, Begriffe und Orientierungen aus der nichtjüdischen Welt, wie umgekehrt nationale Kulturen Elemente aus der jüdischen Sphäre aufgriffen. Die systematische Einbeziehung solcher Kulturtransfers, so wird in diesem Band gezeigt, bereichert den Blick auf die jüdische Geschichte und kann neue Impulse für weitere Forschungen geben.
Autorentext
Wolfgang Schmale ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte in Wien. Martina Steer, Dr. phil., ist Historikerin in Berlin.
Klappentext
Kulturelle Austauschprozesse sind ein in Bezug auf die jüdische Geschichte bislang vernachlässigtes Thema. Dabei übernahmen Juden häufig Werte, Begriffe und Orientierungen aus der nichtjüdischen Welt, wie umgekehrt nationale Kulturen Elemente aus der jüdischen Sphäre aufgriffen. Die systematische Einbeziehung solcher Kulturtransfers, so wird in diesem Band gezeigt, bereichert den Blick auf die jüdische Geschichte und kann neue Impulse für weitere Forschungen geben.
Leseprobe
Die meisten Arbeiten zur jüdischen Geschichte, so der Historiker Amos Funkenstein 1995 in seinem Aufsatz The Dialectics of Assimilation, hätten eines gemeinsam: die Besessenheit von der Originalität und Ursprünglichkeit. Versuche, eine unveränderliche "Essenz" des Jüdischen herauszufiltern, welche die Kontinuität der jüdischen Vergangenheit begründet, und die Abgrenzung dieser jüdischen "Essenz" gegen weniger bedeutende, meist sogar schädliche, temporäre "Erscheinungen" kennzeichneten einen großen Teil der jüdischen Historiographie, so Funkenstein. Als Beispiele nennt er unter anderem Heinrich Graetz' Essay Die Construction der jüdischen Geschichte aus dem Jahr 1846, in dem Graetz die jüdische Geschichte als "die Geschichte einer und derselben Idee - die Idee des reinen Monotheismus" bezeichnet hatte und Gershom Scholems Arbeiten, die zu einem großen Teil dem Versuch, das Alter und den autochthonen Charakter der Kabbala nachzuweisen, gewidmet waren. Dass die Suche nach dem Ursprünglichen im Jüdischen nach wie vor Konjunktur hat, zeigen jüngere Arbeiten wie etwa Marion Kaplans The Making of the Jewish Middle Class, in der der Beweis angetreten wird, dass die angeblich assimilierte bürgerliche deutsch-jüdische Familie viel jüdischer war als bisher angenommen, oder Michael Brenners Untersuchung der Jüdischen Renaissance in Deutschland, The Renaissance of Jewish Culture in Weimar Germany. Der Begriff der Assimilation und dessen negative Konnotation spielten in der jüdischen Historiographie nach der Shoa tatsächlich eine besondere Rolle. Die Geschichte des postemanzipatorischen Judentums wurde als eine Geschichte der Krisen gezeichnet und das 19. und 20. Jahrhundert als eine Zeit der Degeneration des Diasporajudentums interpretiert. Als typische Kennzeichen dieser assimilatorischen Entwicklung wurden Austritte, Konversionen, Mischehen, abnehmende Observanz gegenüber den religiösen Geboten und zunehmende Anpassung an die christliche Umwelt angesehen. Da implizit immer die Frage mitschwang: Wie konnte es zur Shoa kommen? Was waren die Ursachen und Gründe?, lag die Antwort bereits vorher fest. Es wurde, insbesondere von zionistischen Historikerinnen und Historikern, die von jeher ein ambivalentes Verhältnis zum vermeintlich homogen assimilierten Diasporajudentum hatten, eine Emanzipationsgeschichte geschrieben, die keinen anderen möglichen Ausgang haben konnte als Selbstzerstörung oder Zerstörung durch andere. Erst in den letzten zwanzig Jahren konnte sich die jüdische Historiographie von dieser Sichtweise lösen und interpretierte die Verbürgerlichung des Judentums nicht mehr nur als weiteren Schritt hin zur Vernichtung. Vor allem Forscherinnen und Forscher außerhalb Israels machten sich auf die Suche nach dem "Jüdischen" im Diasporajudentum - und fanden es auch, wie bereits oben erwähnt, in der bürgerlichen jüdischen Familie oder in intellektuellen Strömungen innerhalb des Judentums. An die Stelle des Assimilationsnarrativs, nämlich dass das Diasporajudentum seine Wertvorstellungen und Lebensgewohnheiten an die nichtjüdische Kultur angeglichen und alles Jüdische aufgegeben hätte, trat ein neues Narrativ: Das Diasporajudentum war nicht in der deutschen Gesellschaft aufgegangen, sondern war im Kern "jüdisch" geblieben und hatte nur ausgewählte Elemente aus der nichtjüdischen Umwelt aufgenommen, wie Sprache und Kleidung. Während englisch- und hebräischsprachige Forscherinnen und Forscher nach wie vor an den Begriffen assimilation (der nicht negativ konnotiert ist) bzw. hitbolelut festhalten, bürgerte sich in der deutschsprachigen Forschung der Begriff der "Akkulturation" ein. Mit dieser wissenschaftlichen Rehabilitation des Diasporajudentums ging also keine Rehabilitation des Phänomens der Assimilation einher. Diese blieb weiterhin weitgehend negativ konnotiert. Die Entwicklung des postemanzipatorischen Diasporajudentums wurde nur nicht mehr mit der "bösen" Assimilation erklärt, sondern mit der "guten", zweckgebundenen Akkulturation. Für diesen Paradigmenwechsel nennt der Historiker Todd Endelman zwei Gründe: Als Reaktion auf eine zionistische Interpretation der jüdischen Geschichte unterstellten vor allem die in der amerikanischen Diaspora lebenden Historikerinnen und Historiker den früheren Generationen der Diasporajuden ein ähnliches positives Heimatgefühl, wie sie selbst es in den USA empfänden. Vor allem aber die Angriffe von Autoren wie Hannah Arendt oder Raul Hilberg gegen das europäische Judentum hätten diese Verteidigungshaltung provoziert.
Inhalt
Inhalt Vorwort 7 Einleitung: Jüdische Geschichte und Kulturtransfer 10 Martina Steer (Wien/Berlin) Erkenntnisinteressen der Kulturtransferforschung 23 Wolfgang Schmale (Wien) Kultur in einer "Welt in Bewegung": Theoretische Überlegungen zu kultureller Differenz und Kulturtransfer 42 Werner Suppanz (Graz) Zum Wandel des Selbstverständnisses zentraleuropäischer Juden durch Kulturtransfer 57 Klaus Hödl (Jerusalem/Graz) Kulturtransfers unter Juden in Frankreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 83 Michel Espagne (Paris) Konkurrenz und Kompromiss: Das jüdisch-theologische Seminar im viktorianischen England 97 Gregor Pelger (London) Goethe und Schiller im Schtetl - Literarische Transferprozesse und Leseszenen in deutschsprachig jüdischer Erzählliteratur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 123 Petra Ernst (Graz) Mesussot entfernen - Türschilder entfernen Die Emigration der Gegenstände von Deutschland nach Palästina 153 Joachim Schlör (Potsdam) Immigrationspolitik im Wandel: Transferprozesse Down Under 173 Birgit Lang (Melbourne) Autorinnen und Autoren 187 Register 191
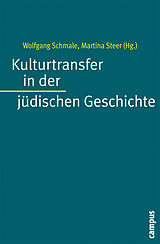
Leider konnten wir für diesen Artikel keine Preise ermitteln ...
billigbuch.ch sucht jetzt für Sie die besten Angebote ...
Die aktuellen Verkaufspreise von 6 Onlineshops werden in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
Loading...
Die aktuellen Verkaufspreise von 6 Onlineshops werden in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
| # | Onlineshop | Preis CHF | Versand CHF | Total CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seller | 0.00 | 0.00 | 0.00 |